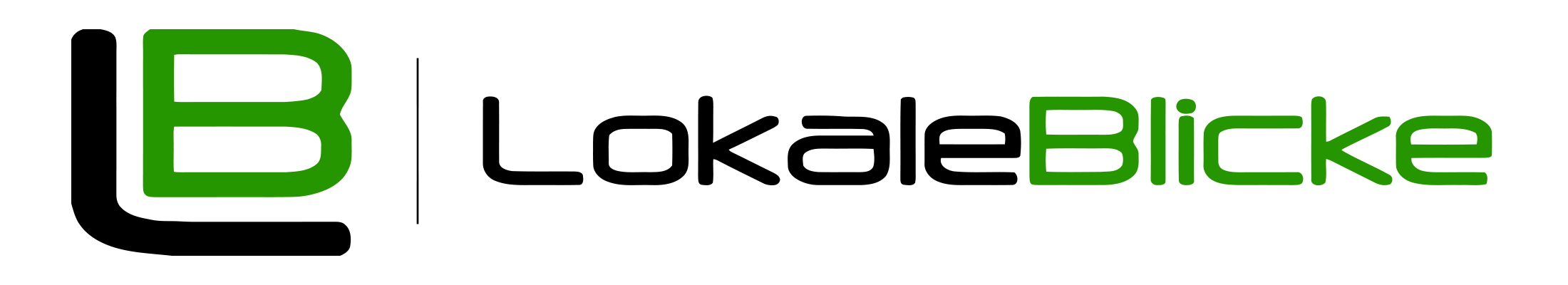Stärkung des Dialogs: Türkisch-Deutsches Medienforum in Ankara
Am 9. April 2025 fand in Ankara das Türkisch-Deutsche Medienforum statt – organisiert von der Präsidentschaft für Kommunikation der Republik Türkei. Ziel der hochkarätig besetzten Veranstaltung war es, die Beziehungen zwischen der deutschen und der türkischen Medienlandschaft zu vertiefen, gemeinsame Herausforderungen wie Desinformation zu thematisieren und der Rolle der Diasporamedien in den bilateralen Beziehungen mehr Sichtbarkeit zu geben.

Eröffnet wurde das Forum mit Reden von Prof. Dr. Fahrettin Altun, Leiter des Präsidialamts für Kommunikation, und Botschafter Akif Çağatay Kılıç, außenpolitischer Chefberater des türkischen Präsidenten. In drei thematischen Panels diskutierten namhafte Persönlichkeiten aus Medien, Wissenschaft und Politik aktuelle Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, politischer Realität und gesellschaftlicher Verantwortung.
Panel 1: Gemeinsame Geschichten, geteilte Verantwortung
Den Auftakt machte die Diskussionsrunde „Zwei Länder, gemeinsame Geschichten: Türkisch-deutsche Zusammenarbeit in den Medien“, moderiert von Prof. Dr. Cemal Yıldız, dem Rektor der Türkisch-Deutschen Universität. Auf dem Podium sprachen unter anderem Eckart Cuntz, ehemaliger deutscher Botschafter in Ankara, Ahmet Külahçı, Europa-Koordinator der Hürriyet, Steffen Gassel, Diplomatie-Reporter des Magazins Stern, sowie Dursun Yiğit, Chefredakteur von TV Berlin.
Das Panel thematisierte die mediale Darstellung beider Länder im jeweils anderen sowie Chancen und Herausforderungen journalistischer Kooperationen. Dabei wurden sowohl Stereotypen als auch Missverständnisse in der Berichterstattung angesprochen.
Panel 2: Diaspora und Medien – Zwischen Repräsentation und Verantwortung
Im zweiten Panel „Die türkische Diaspora in Deutschland: Die Rolle der Medien in Repräsentation und kulturellen Beziehungen“ stand die Community von über 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland im Fokus. Moderiert von Prof. Dr. Enes Bayraklı von der Stiftung für Türkei-Studien, diskutierten Dr. Latif Çelik (Leiter des IKG Instituts), Ali Paşa Akbaş (Kanal Europa) und Dr. Büşra Fadim Sarıkaya Tünalp (Türkisch-Deutsche Universität) über die Bedeutung einer differenzierten Medienberichterstattung, die zwischen Integration, Identität und gesellschaftlicher Teilhabe vermittelt.
Panel 3: Medienverantwortung im Zeitalter der Desinformation
Die letzte Diskussionsrunde – „Verantwortung der Medien im Zeitalter der Desinformation“ – wurde von İdris Kardaş, Koordinator des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation beim Kommunikationspräsidium, geleitet. Die Panelteilnehmenden – darunter der Politikanalyst Klaus Jürgens, Hakkı Alkan (Gründer von shiftdelete.net), Ömer Faruk Görçin (Anadolu Ajansı) und Hayrettin Özcan, Chefredakteur von NRW Haber – warnten eindringlich vor den Gefahren von Fake News und digitaler Manipulation. Der Tenor: Medien tragen im digitalen Zeitalter mehr denn je Verantwortung für Fakten, Ethik und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Altun: „Pressefreiheit ja – aber nicht für Desinformation und Terrorpropaganda“

In seiner Grundsatzrede unterstrich Prof. Dr. Fahrettin Altun das Anliegen des Forums: Medienkooperationen zu stärken, strategische Dialogräume zu schaffen und gemeinsam globale Herausforderungen zu reflektieren.
Altun warnte eindringlich vor der Instrumentalisierung von Medien durch extremistische Gruppierungen. Es sei inakzeptabel, dass Personen, die Propaganda für Terrororganisationen betreiben, in westlichen Medien als „Experten“ auftreten dürften. Medien dürften kein Sprachrohr für Extremismus, sondern müssten ein Bollwerk gegen Hass und Spaltung sein.
Auch die europäische Sicherheit wurde thematisiert: „Ein Sicherheitssystem ohne die Türkei kann für Europa keine tragfähige Lösung sein“, so Altun. Die Türkei sei mit ihrer geostrategischen Lage, ihrem militärischen Potenzial und ihrer diplomatischen Reichweite ein unverzichtbarer Akteur.
Er sprach sich zudem für eine stärkere Vertretung der türkischen Diaspora in deutschen Medien aus – und forderte einen klaren Kampf gegen Rassismus und Islamfeindlichkeit: „Rassismus ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass er normalisiert wird.“
Abschließend betonte Altun, dass türkische Medien wie Anadolu Ajansı, TRT Deutsch oder TRT World zur Medienvielfalt beitragen – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Türkei sei bereit, mit Deutschland gemeinsam Projekte zu realisieren, Inhalte wie Dokumentationen oder Serien zu produzieren, Journalistenaustauschprogramme zu fördern und gemeinsam gegen Desinformation vorzugehen.
Kılıç: „Kritik ja, aber bitte keine Doppelmoral“

Auch Botschafter Akif Çağatay Kılıç äußerte sich in seiner Rede kritisch gegenüber der Berichterstattung einiger deutscher Medien über die Türkei. Es sei auffällig, wie oft die Türkei wegen vermeintlicher Demokratiedefizite kritisiert werde, während massive Menschenrechtsverletzungen in anderen Regionen – wie in Gaza – kaum thematisiert würden.
„Wenn Medien nicht in der Lage sind, einen Völkermord als solchen zu benennen, verlieren sie an Glaubwürdigkeit“, so Kılıç. Er kritisierte zudem, dass in Deutschland gesuchte Personen ungehindert auftreten und die öffentliche Meinung über die Türkei beeinflussen könnten – oftmals ohne fundierte Sachkenntnis, dafür aber mit politischer Agenda.
Dennoch plädierte Kılıç für Dialog: „Türkei und Deutschland werden auch künftig enge Partner bleiben – trotz Meinungsverschiedenheiten. Medien auf beiden Seiten können hier eine konstruktive Rolle spielen.“
Fazit: Ein Forum mit Signalwirkung
Das Türkisch-Deutsche Medienforum 2025 markierte einen wichtigen Schritt zur Vertiefung des bilateralen Dialogs im Medienbereich. In einer Zeit globaler Unsicherheiten, politischer Polarisierung und digitaler Desinformation setzt die Veranstaltung ein starkes Zeichen: für Kooperation statt Konfrontation, für Vielfalt statt Einseitigkeit – und für die gemeinsame Verantwortung, Medien zu einem Werkzeug für Wahrheit, Frieden und Verständigung zu machen.

Ob es gelingt, diese Impulse langfristig zu institutionalisieren, wird auch davon abhängen, wie ernst Medien beider Länder ihre gesellschaftliche Verantwortung nehmen.